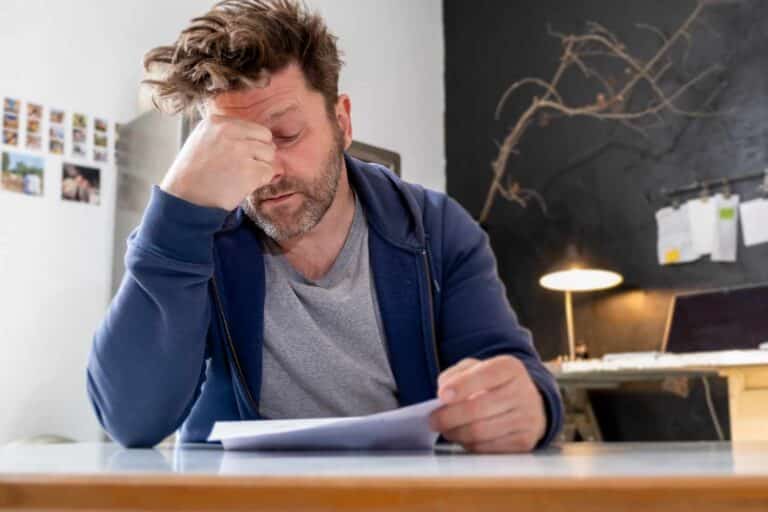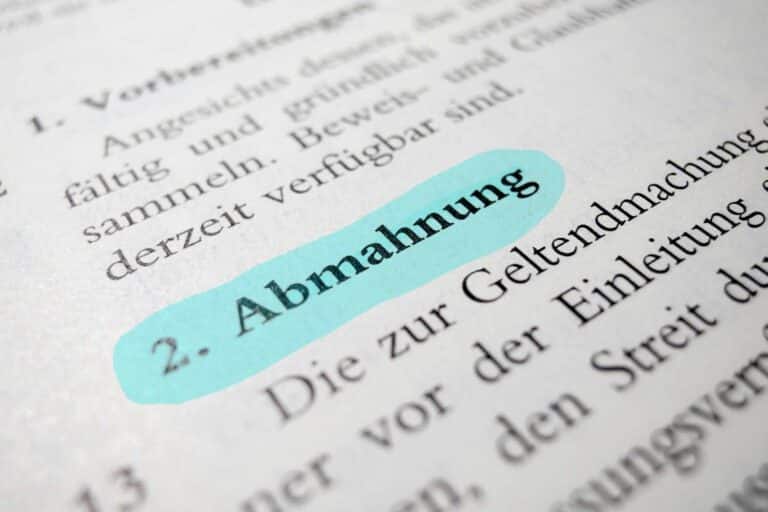Nach einer Scheidung ist die finanzielle Situation beider Ex-Partner oft ein zentrales Thema. Während im Trennungsjahr noch ein Anspruch auf Trennungsunterhalt besteht, endet dieser mit der rechtskräftigen Scheidung. Ab diesem Zeitpunkt gilt das Prinzip der Eigenverantwortung: Jeder Ex-Partner ist ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich selbst für die Sicherung seines Lebensunterhalts verantwortlich (§ 1569 BGB).

Allerdings gibt es Ausnahmen: Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen. Diese finanzielle Unterstützung soll wirtschaftliche Nachteile ausgleichen, die durch die Ehe und deren Auflösung entstanden sind.
In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Voraussetzungen für einen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt erfüllt sein müssen, welche Unterhaltstatbestände das Gesetz vorsieht und wie sich dieser Anspruch vom Trennungsunterhalt unterscheidet. Außerdem gehen wir darauf ein, wie lange nachehelicher Unterhalt gezahlt werden muss und welche Faktoren – wie z.B. der Grundsatz der Billigkeit (§ 1579 BGB) – Einfluss auf Höhe und Dauer haben können.
Übersicht:
- Was ist nachehelicher Unterhalt?
- Ist nachehelicher Unterhalt das gleiche wie Trennungsunterhalt?
- Unter welchen Voraussetzungen erhält man nachehelichen Unterhalt?
- Wie lange muss man den nachehelichen Unterhalt zahlen?
- Fazit
- FAQ
1. Was ist nachehelicher Unterhalt?
Während die scheidungswilligen Ehepartner im Trennungsjahr noch rechtlich und finanziell aneinandergebunden sind, entfällt diese Bindung mit der rechtskräftigen Scheidung. Nach der Scheidung muss daher jeder Ex-Partner für seinen Lebensunterhalt selbst sorgen. Diesem Grundsatz trägt auch das Bürgerliche Gesetzbuch in § 1569 Satz 1 BGB Rechnung.
Grundsatz der Selbstverantwortlich für den Lebensunterhalt nach der Scheidung
Mit der Reform des § 1569 BGB im Jahr 2008 hat der Gesetzgeber die Eigenverantwortung und Selbstverantwortlichkeit der ehemaligen Ehepartner nach der Scheidung stärker in den Vordergrund gerückt und grundsätzlich gestärkt. Von diesem Regelfall des § 1569 Satz 1 BGB regelt Satz 2 jedoch eine Ausnahme: Trotz Eigenverantwortung und rechtlicher Trennung nach rechtskräftiger Scheidung kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt unter den Voraussetzungen der §§ 1570 ff. BGB bestehen.
Nachehelicher Unterhalt als Ausnahme
Unter nachehelichem Unterhalt versteht man die finanzielle Unterstützung, die ein geschiedener Ex-Ehepartner dem anderen nach rechtskräftiger Scheidung schuldet. Ziel des nachehelichen Unterhalts ist es, wirtschaftliche Nachteile auszugleichen, die durch die Ehe und deren Beendigung entstanden sind. Dabei trägt das Gesetz dem Umstand Rechnung, dass während der Ehe häufig gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, die die berufliche und finanzielle Situation der Ehepartner nachhaltig beeinflussen.
So kann ein Ehepartner zugunsten z.B. der Familie, der Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen auf eine berufliche Karriere verzichten, während der andere Ehepartner seine beruflichen Möglichkeiten voll ausschöpft. Nach der Scheidung kann daher ein finanzieller Ausgleich erforderlich sein, um den wirtschaftlich schwächeren Partner abzusichern.
Nachehelicher Unterhalt nur bei Vorliegen eines Unterhaltstatbestands
Wegen des Grundsatzes der Eigenverantwortung wird nachehelicher Unterhalt nur ausnahmsweise und nur dann gewährt, wenn der bedürftige Ehepartner seinen Unterhalt nicht aus eigenen Mitteln wie Einkommen oder Vermögen bestreiten kann und der unterhaltspflichtige Partner wirtschaftlich leistungsfähig ist.
Außerdem muss ein gesetzlich anerkannter Grund, ein sogenannter Unterhaltstatbestand, vorliegen. Nur wenn ein solcher Unterhaltstatbestand gegeben ist, kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen. Die Voraussetzungen des nachehelichen Unterhalts sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere in den §§ 1569 bis 1586b BGB geregelt.
2. Ist nachehelicher Unterhalt das gleiche wie Trennungsunterhalt?
Der Unterschied zwischen nachehelichem Unterhalt und Trennungsunterhalt liegt vor allem im Zeitpunkt, in den rechtlichen Voraussetzungen sowie in der Zielsetzung der beiden Unterhaltsformen. Während der Trennungsunterhalt während des Getrenntlebens, also vor der rechtskräftigen Scheidung, gezahlt wird, greift der nacheheliche Unterhalt erst nach der Scheidung als Ausnahme vom Grundsatz der Eigenverantwortung für den Lebensunterhalt, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beide Formen dienen dem Ausgleich wirtschaftlicher Ungleichheiten zwischen den Ehepartnern, unterscheiden sich jedoch in ihrer gesetzlichen Grundlage und Zielsetzung.
Trennungsunterhalt: Unterhalt während der Trennungsphase
Der Trennungsunterhalt ist in § 1361 BGB geregelt. In der Zeit zwischen Trennung und Scheidung besteht weiterhin eine wirtschaftliche Solidarität zwischen den Ehepartnern, da die Ehe rechtlich noch nicht beendet ist. Der wirtschaftlich stärkere Partner ist verpflichtet, den anderen finanziell zu unterstützen, um den bisherigen Lebensstandard während der Ehe möglichst aufrecht zu erhalten. Es wird nicht erwartet, dass der bedürftige Partner während der Trennungszeit einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Vielmehr dient diese Phase dazu, die eigene Lebenssituation neu zu ordnen. Der Anspruch auf Trennungsunterhalt endet automatisch mit der rechtskräftigen Scheidung.

Mehr zum Thema Scheidung lesen Sie in diesem Beitrag.
Nachehelicher Unterhalt: Ausnahme von der Regel
Demgegenüber setzt der nacheheliche Unterhalt nach der rechtlichen Beendigung der Ehe ein. Er ist in den §§ 1569 bis 1586b BGB geregelt und geht von einem anderen Grundsatz aus: Nach der Scheidung soll grundsätzlich jeder Ehepartner für sich selbst sorgen. Nur wenn dies aus bestimmten, gesetzlich normierten Gründen nicht möglich ist, etwa wegen der Betreuung gemeinsamer Kinder, Krankheit, Alter oder einer notwendigen Ausbildung, kann ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen.
Der Zweck des nachehelichen Unterhalts liegt also stärker in der Förderung der Eigenverantwortung. Anders als beim Trennungsunterhalt muss sich der bedürftige Partner im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv um eine eigenständige Sicherung seines Lebensunterhalts bemühen. Der nacheheliche Unterhalt kann befristet oder in Ausnahmefällen, z.B. bei langer Ehedauer oder schwerer Krankheit, unbefristet gewährt werden.
Trennungsunterhalt oder nachehelicher Unterhalt
Insgesamt soll der Trennungsunterhalt während der Trennung den ehelichen Lebensstandard sichern, während der nacheheliche Unterhalt nach der Scheidung nur dann greift, wenn besondere Umstände eine eigenständige Lebensführung des bedürftigen Partners unmöglich machen. Zudem endet der Trennungsunterhalt automatisch mit der Scheidung, während der nacheheliche Unterhalt individuell ausgestaltet und in der Regel befristet ist.
3. Unter welchen Voraussetzungen erhält man nachehelichen Unterhalt?
Nach dem Grundsatz der Eigenverantwortung trifft jeden Ehepartner nach der Scheidung die Obliegenheit, eine Erwerbstätigkeit auszuüben oder sich darum zu bemühen (§ 1574 Abs. 1 BGB). Dies muss dem ehemaligen Ehepartner auch möglich und zumutbar sein. Nur wenn eine Erwerbstätigkeit unzumutbar ist oder der eigene Lebensunterhalt durch zumutbare Anstrengungen nicht gesichert werden kann, kommt ein nachehelicher Unterhaltsanspruch in Betracht.
Nach § 1574 Abs. 2 BGB ist eine Erwerbstätigkeit zumutbar, wenn sie der Ausbildung, den Fähigkeiten, der bisherigen Erwerbstätigkeit sowie dem Alter und dem Gesundheitszustand des früheren Ehepartners entspricht. Werden vorsätzlich Umstände oder Gründe dafür geschaffen, dass ein Ex-Partner nicht für sich selbst sorgen kann und dadurch bedürftig wird, kann dies dazu führen, dass auch ein nachehelicher Unterhalt ausgeschlossen ist.
Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit
Ist der unterhaltsberechtigte Ex-Partner unter Berücksichtigung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit und vorhandenem Vermögen nicht in der Lage, seinen Unterhalt zu sichern, ist er bedürftig. Neben der Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Ex-Partners muss der andere Ex-Partner als möglicher Unterhaltspflichtiger leistungsfähig sein.
Nach § 1581 Satz 1 BGB ist der unterhaltspflichtige Ex-Partner nur dann zur Unterhaltszahlung verpflichtet, wenn er dazu finanziell in der Lage ist, ohne selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Ihm muss also aus seiner Erwerbstätigkeit so viel verbleiben, dass er seinen eigenen angemessenen Unterhalt bestreiten kann. Ist er aufgrund seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder sonstiger finanzieller Verpflichtungen nicht in der Lage, den vollen Unterhalt zu zahlen, wird geprüft, was für beide Seiten billig und wirtschaftlich zumutbar ist. Der Unterhalt wird dann so angepasst, dass er für beide Ex-Partner gerecht und angemessen bleibt.
Unterhaltstatbestände
Eine zentrale Voraussetzung für den nachehelichen Unterhalt ist, dass der unterhaltsberechtigte Ex-Ehepartner seinen Unterhaltsanspruch auf einen der sieben gesetzlichen Unterhaltstatbestände stützen kann. Der Ex-Partner muss beweisen, dass sein Anspruch besteht und dass er aus diesen Gründen nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann.
Bei den Unterhaltstatbeständen handelt es sich um:
- Betreuungsunterhalt (§ 1570 BGB): Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt kann bestehen, wenn der berechtigte Partner gemeinsame Kinder betreut und deshalb keiner oder nur einer eingeschränkten Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Die Dauer des Anspruchs richtet sich nach dem Alter und der Betreuungsbedürftigkeit der Kinder. In den ersten drei Lebensjahren des Kindes besteht in der Regel immer ein Unterhaltsanspruch. Danach ist der betreuende Ex-Ehepartner verstärkt verpflichtet, durch Erwerbstätigkeit für seinen eigenen Unterhalt zu sorgen. Dies gilt nur für den nachehelichen Unterhalt und ist vom Kindesunterhalt zu unterscheiden.
- Unterhalt wegen Alters (§ 1571 BGB): Ein Anspruch kann bestehen, wenn der unterhaltsberechtigte Ehepartner aufgrund seines Alters nicht mehr in der Lage ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
- Unterhalt wegen Krankheit (§ 1572 BGB): Kann der geschiedene Ehepartner wegen Krankheit oder anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, kann ein Unterhaltsanspruch bestehen. Wichtig dabei ist, dass die Krankheit schon vor der Scheidung eingetreten sein muss.
- Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit (§ 1573 Abs. 1 BGB): Ein Anspruch kann bestehen, wenn der geschiedene Ehepartner ohne eigenes Verschulden keine Erwerbstätigkeit findet. Der geschiedene Ehepartner, der weder zu alt noch gesundheitlich beeinträchtigt ist und keine Kinder zu betreuen hat, ist jedoch grundsätzlich verpflichtet, sich um eine angemessene Erwerbstätigkeit zu bemühen und damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
- Aufstockungsunterhalt (§ 1573 Abs. 2 BGB): Dieser Anspruch besteht, wenn der bedürftige Ex-Partner erwerbstätig ist, sein Einkommen aber nicht ausreicht, um den Lebensstandard zu halten. Der Unterhaltsanspruch ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Einkommen des unterhaltsberechtigten Ex-Ehepartners und dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Ex-Ehepartners.
- Ausbildungs-, Fortbildungs- oder Umschulungsunterhalt (§ 1575 BGB): Ein Anspruch kann bestehen, wenn der bedürftige Ehepartner eine Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung benötigt, um finanziell unabhängig zu werden. Hat der Ehepartner die Ausbildung nicht in Erwartung der Eheschließung begonnen oder wegen der Ehe nicht begonnen oder nicht abgeschlossen, kann die Ausbildung nachgeholt werden und für die Zeit bis zum Abschluss der Ausbildung ein Anspruch auf Ausbildungsunterhalt bestehen.
- Unterhalt aus Gründen der Billigkeit (§ 1576 BGB): Dieser Anspruch kann in besonderen Härtefällen gewährt werden, z.B. nach sehr langer Ehe oder bei außergewöhnlichen Umständen, die eine Eigenverantwortung unzumutbar machen. Es wäre grob unbillig, in diesen Fällen keinen Unterhalt zu gewähren, auch wenn keiner der anderen Unterhaltstatbestände vorliegt. Es müssen allerdings schwerwiegende Gründe vorliegen, die eine Erwerbstätigkeit unzumutbar machen und damit einen solchen Unterhaltstatbestand rechtfertigen. Beispiele sind neben einer langen Ehedauer die Pflege von Angehörigen des Ehepartners (etwa die Schwiegereltern) während der Ehe.

Mehr zum Thema Unterhalt lesen Sie in diesem Beitrag.
4. Wie lange muss man den nachehelichen Unterhalt zahlen?
Die Dauer des nachehelichen Unterhalts kann je nach den persönlichen Verhältnissen und den Unterhaltstatbeständen unterschiedlich sein. Es gibt keine allgemeingültige Regel, die für alle Konstellationen gilt. Vielmehr spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie die Dauer der Ehe, die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse der früheren Ehepartner sowie die jeweiligen Unterhaltstatbestände.
Wird z.B. nachehelicher Unterhalt für eine Ausbildung gewährt, so sollte der geschiedene Ex-Partner nach Abschluss der Ausbildung selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen können und der nacheheliche Unterhalt endet. Gleiches gilt für den Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit oder den Aufstockungsunterhalt, wenn der unterhaltsberechtigte Ex-Partner eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit aufnimmt.
Bei bestimmten Unterhaltstatbeständen, z.B. Unterhalt wegen Alters oder Krankheit, kann die Unterhaltsleistung aus individuellen Gründen auch unbefristet sein, wenn der frühere Ehepartner dauerhaft nicht in der Lage ist, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen.
Grobe Unbilligkeit des nachehelichen Unterhalts
Außerdem gibt es Faktoren und Umstände, die dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch herabgesetzt oder nur für einen bestimmten Zeitraum gerechtfertigt werden kann. Die Vorschrift des § 1579 BGB regelt daher den Ausschluss oder die Begrenzung des nachehelichen Unterhalts, wenn es dem unterhaltspflichtigen Ehepartner nicht zuzumuten ist, den Unterhalt ganz oder teilweise zu erbringen. Zweck der Vorschrift ist es, im Einzelfall die Billigkeit (Gerechtigkeit) zwischen den geschiedenen Ehepartnern zu wahren.
Der Unterhaltsanspruch kann ganz oder teilweise ausgeschlossen, zeitlich begrenzt oder herabgesetzt werden, wenn das Verhalten oder die Verhältnisse des unterhaltsberechtigten Ex-Partners dies rechtfertigen. Solche Gründe nennt das Gesetz beispielhaft in § 1579 BGB.
- Kurze Ehedauer: Die Ehe dauerte nur kurze Zeit, so dass die Zahlung von Unterhalt auf Dauer unzumutbar wäre. Als Richtwert gelten hier etwa zwei Jahre.
- Schweres Fehlverhalten: Der unterhaltsberechtigte Partner hat sich eines Verbrechens oder eines schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den unterhaltspflichtigen Partner oder dessen Angehörige schuldig gemacht (z.B. Gewalt, schwere Beleidigungen).
- Wirtschaftliche Besserstellung: Der unterhaltsberechtigte Partner lebt in wirtschaftlich besseren Verhältnissen als der Unterhaltspflichtige, z.B. durch eine neue Partnerschaft.
- Mutwillige Herbeiführung der Bedürftigkeit: Der unterhaltsberechtigte Ex-Partner hat seine Bedürftigkeit mutwillig herbeigeführt, z.B. durch Abbruch einer zumutbaren Ausbildung. Der unterhaltspflichtige Partner soll die Folgen der Mutwilligkeit nicht durch Unterhaltszahlungen tragen müssen.
- Neue feste Lebensgemeinschaft: Der berechtigte Partner lebt in einer neuen festen Partnerschaft oder in einer neuen Ehe.
- Verweigerung einer Erwerbstätigkeit: Der berechtigte Partner kommt seiner Verpflichtung, sich um eine eigene Erwerbstätigkeit zu bemühen, nicht nach.
- Einseitiges Fehlverhalten: Dem unterhaltsberechtigten Ex-Partner kann ein einseitiges, in seiner Person liegendes Fehlverhalten gegenüber dem unterhaltspflichtigen Ex-Partner vorgeworfen werden. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Ehefrau mit einem anderen Mann ein Kind bekommt und es dem Ehepartner als „Kuckuckskind“ unterschiebt. Der bloße Ehebruch, also der außereheliche Geschlechtsverkehr, ist für sich genommen noch nicht geeignet, Auswirkungen auf den nachehelichen Unterhalt zu haben. Allerdings können bestimmte Begleitumstände, wie z.B. die Aufnahme einer neuen Beziehung aus einer intakten Ehe heraus, Auswirkungen auf den Anspruch auf nachehelichen Unterhalt haben. Gleiches gilt für die Aufnahme intimer Beziehungen zu mehreren Sexualpartnern, die Tätigkeit als Prostituierte oder eine sexuelle Affäre der Ehefrau mit dem besten Freund des Ehemannes während dessen Abwesenheit.
5. Fazit
- Grundsatz der Eigenverantwortung: Nach der Scheidung gilt der Grundsatz, dass jeder Ex-Partner selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen muss (§ 1569 BGB). Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt ist nur die Ausnahme und setzt voraus, dass der bedürftige Ex-Partner seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkünften oder Vermögen bestreiten kann.
- Unterhaltstatbestände als Voraussetzung: Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt besteht nur, wenn ein gesetzlich anerkannter Unterhaltstatbestand vorliegt. Die wichtigsten sind Betreuungsunterhalt (z.B. für Kinder), Unterhalt wegen Alters, Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Aufstockungsunterhalt, Ausbildungsunterhalt oder Unterhalt aus Billigkeitsgründen (§§ 1570-1576 BGB).
- Unterscheidung zwischen Trennungsunterhalt und nachehelichem Unterhalt: Trennungsunterhalt wird während des Getrenntlebens vor der Scheidung gezahlt und endet mit der rechtskräftigen Scheidung. Der nacheheliche Unterhalt beginnt erst nach der Scheidung. Er dient nur in Ausnahmefällen dem Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, die durch die Ehe entstanden sind.
- Dauer des nachehelichen Unterhalts: Die Dauer des nachehelichen Unterhalts richtet sich nach dem Einzelfall. In vielen Fällen ist der Unterhalt befristet, etwa bis der bedürftige Partner eine Ausbildung abgeschlossen oder eine Erwerbstätigkeit aufgenommen hat. Bei besonderen Unterhaltstatbeständen wie Alter oder Krankheit kann der Unterhalt auch unbefristet sein.
- Einfluss des Billigkeitsgrundsatzes (§ 1579 BGB): Der Unterhaltsanspruch kann ausgeschlossen, herabgesetzt oder zeitlich begrenzt werden, wenn dem unterhaltspflichtigen Partner die Zahlung des Unterhalts nicht zuzumuten ist. Gründe können z.B. eine kurze Ehedauer, ein schwerwiegendes Fehlverhalten des unterhaltsberechtigten Partners oder eine neue verfestigte Lebensgemeinschaft des Berechtigten sein.
- Ziel des nachehelichen Unterhalts: Der nacheheliche Unterhalt soll wirtschaftliche Nachteile ausgleichen, die durch die Ehe und deren Beendigung entstanden sind. Besonders berücksichtigt werden dabei gemeinsame Entscheidungen während der Ehe, wie der Verzicht auf eine Karriere zugunsten von Kinderbetreuung oder Pflege. Ziel ist es jedoch, die Eigenverantwortung des bedürftigen Partners so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Unsere Anwälte für Familienrecht in Hildesheim bieten Ihnen rechtliche Beratung und Vertretung in allen familienrechtlichen Angelegenheiten an. Kontaktieren Sie uns gerne.
6. FAQ
Was ist nachehelicher Unterhalt und wann besteht ein Anspruch darauf?
Nachehelicher Unterhalt ist eine finanzielle Unterstützung, die ein geschiedener Ehepartner nach rechtskräftiger Scheidung an den anderen zahlt. Ein Anspruch besteht nur ausnahmsweise, wenn der bedürftige Ex-Partner seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln wie Einkommen oder Vermögen bestreiten kann. Außerdem muss einer der gesetzlich anerkannten Unterhaltstatbestände erfüllt sein.
Welches sind die wichtigsten Unterhaltstatbestände?
Die häufigsten Anspruchsgrundlagen für nachehelichen Unterhalt sind der Betreuungsunterhalt, wenn der bedürftige Partner gemeinsame Kinder betreut und deshalb keiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann (§ 1570 BGB), sowie der Unterhalt wegen Alters (§ 1571 BGB) oder Krankheit (§ 1572 BGB), wenn eine Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich ist. Von Bedeutung ist auch der so genannte Aufstockungsunterhalt (§ 1573 Abs. 2 BGB), der gewährt wird, wenn das Einkommen des berechtigten Partners nicht ausreicht, um den ehelichen Lebensstandard zu halten. Daneben gibt es den Ausbildungsunterhalt (§ 1575 BGB), der eine finanzielle Unterstützung für eine Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung ermöglicht.
Was ist der Unterschied zwischen nachehelichem Unterhalt und Trennungsunterhalt?
Der Trennungsunterhalt wird während des Getrenntlebens vor der Scheidung gezahlt und endet mit der rechtskräftigen Scheidung. Er beruht auf der ehelichen Solidarität, die auch während der Trennungszeit fortbesteht. Im Gegensatz dazu beginnt der nacheheliche Unterhalt erst nach der Scheidung. Er wird nur in Ausnahmefällen gewährt, wenn der bedürftige Partner aus bestimmten Gründen, wie Kinderbetreuung oder Krankheit, nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann.
Wie lange ist nachehelicher Unterhalt zu zahlen?
Die Dauer des nachehelichen Unterhalts hängt vom Einzelfall ab. Häufig wird der Unterhalt befristet, z.B. bis der bedürftige Partner eine Ausbildung abgeschlossen oder eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit aufgenommen hat. In Ausnahmefällen, etwa bei dauerhafter Krankheit oder hohem Alter, kann der Unterhalt aber auch unbefristet gewährt werden.
Welche Rolle spielt das Prinzip der Eigenverantwortung (§1569 BGB)?
Nach der Scheidung gilt der Grundsatz, dass jeder Ex-Partner für sich selbst sorgen muss. Ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt besteht daher nur, wenn der bedürftige Partner aus objektiven Gründen, wie z.B. einer langen Kindererziehungszeit oder gesundheitlichen Einschränkungen, nicht in der Lage ist, selbst für seinen Unterhalt zu sorgen.
Bildquellennachweis: foodandwinephotography | Canva.com