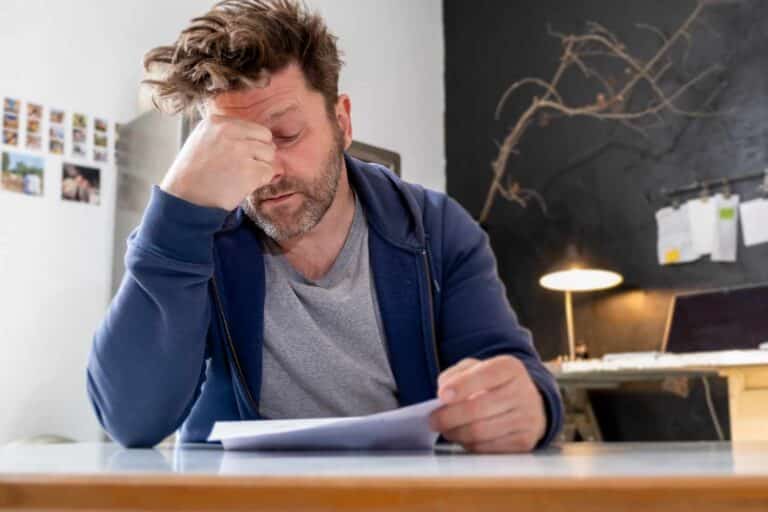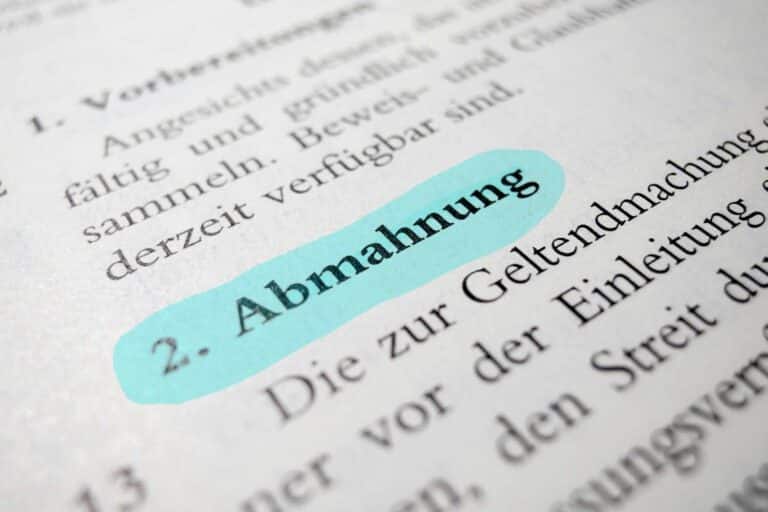Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses gehört zu den sensibelsten Vorgängen im Personalwesen. Wer als Arbeitgeber eine Kündigung rechtswirksam zustellen will, sollte sich unbedingt auf rechtlich sicheres Terrain begeben.

Obwohl die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses gleichbedeutend mit der Abgabe einer einseitigen Willenserklärung ist und damit unkompliziert klingt, ist die Praxis nicht risikolos.
Denn formale Fehler, Zustellungsprobleme oder Missachtung gesetzlicher Vorschriften können dazu führen, dass eine Kündigung unwirksam ist – mit teils erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen.
Davon abgesehen, dass Sie arbeitgeberseitig ein Arbeitsverhältnis nicht grundlos lösen können bedarf auch die Art und Weise des Zugangs der Kündigung eines besonderen Augenmerks. Werden die Formvorschriften nicht beachtet, riskieren Sie die Unwirksamkeit der Kündigung.
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie als Arbeitgeber eine Kündigung korrekt vorbereiten, wirksam zustellen und typische Stolperfallen vermeiden.
Das erwartet Sie:
- Die rechtliche Grundlage
- Die formalen Anforderungen an eine rechtswirksame Kündigung
- Die Zustellung – Wann gilt der Zugang als erfolgt?
- Die Bedeutung des Zugangszeitpunkts für Fristen
- So vermeiden Sie Fehler – Wann ist eine Kündigung unwirksam?
- Unsere Empfehlung – Lassen Sie sich von einem Experten unterstützen
- Fazit
- FAQ
1. Die rechtliche Grundlage
Bei einer Kündigung handelt es sich um eine sogenannte einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die das Arbeitsverhältnis sofort oder nach Ablauf der Kündigungsfrist beendet.
Soll das Arbeitsverhältnis sofort beendet werden, spricht man von einer außerordentlichen Kündigung. Bei einer Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist handelt es sich um eine ordentliche Kündigung.
Das bedeutet, die Kündigung wird erst dann wirksam, wenn sie dem Arbeitnehmer nachweislich zugegangen ist. Gleiches gilt im Umkehrschluss bei einer arbeitnehmerseitigen Kündigung gegenüber dem Arbeitgeber.
Die rechtliche Grundlage findet sich in § 623 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Dort ist geregelt, dass die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses schriftlich erfolgen muss.

Mehr zum Thema Kündigung erfahren Sie in diesem Beitrag.
2. Die formalen Anforderungen an eine rechtswirksame Kündigung
Um eine Kündigung wirksam auszusprechen, müssen Arbeitgeber zwingend die gesetzlichen Formvorgaben einhalten. Diese lauten:
- Die Kündigung muss in Papierform vorliegen, d.h. als schriftliches Dokument, das physisch ausgehändigt oder verschickt wird. Eine Kündigung per E-Mail, Fax oder WhatsApp ist nicht zulässig und damit unwirksam, selbst dann, wenn Ihnen der Mitarbeiter deren Erhalt bestätigt.
- Das Kündigungsschreiben muss eigenhändig von einer kündigungsberechtigten Person unterschrieben sein. Das können Sie als Arbeitgeber selbst sein oder ein hierzu bevollmächtigter Mitarbeiter, etwa die Personalleitung.
- Wird die Kündigung von einer Person ausgesprochen, die nicht kündigungsberechtigt ist (z. B. Teamleitung), muss dem Kündigungsschreiben eine Originalvollmacht beigefügt werden. Andernfalls kann der Arbeitnehmer die Kündigung gemäß § 174 BGB wegen fehlender Vollmacht zurückweisen – mit der Folge, dass sie als nicht erfolgt gilt.
Klären Sie bitte im Rahmen Ihrer Organisationsstrukturen, wer innerhalb Ihres Unternehmens zur Kündigung berechtigt ist. Dokumentieren Sie die interne Vertretungsbefugnis bitte eindeutig, um spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Kündigung zu vermeiden.

Vermeiden Sie Ärger und Gerichtsprozesse und lassen Sie sich von uns als Fachanwälte für Arbeitsrecht beraten.
Die Beratung in der Thematik „Kündigung rechtswirksam zustellen“ gehört zu unseren täglichen Aufgaben. Profitieren Sie von unseren Erfahrungswerten und unserer Expertise.
3. Die Zustellung – Wann gilt der Zugang als erfolgt?
Wie eingangs erwähnt, wird eine Kündigung nur dann wirksam, wenn sie dem Arbeitnehmer wirksam zugeht. Der Zugang ist damit ein entscheidender Moment – denn er beeinflusst nicht nur den Wirksamkeitszeitpunkt der Kündigung, sondern auch den Beginn etwaiger Fristen, etwa für eine Kündigungsschutzklage oder die Berechnung der Kündigungsfrist.
Zugang liegt dann vor, wenn das Kündigungsschreiben so in den Machtbereich Ihres Arbeitnehmers gelangt, dass dieser unter normalen Umständen mit der Kenntnisnahme rechnen kann.
Das Kündigungsschreiben kann auf unterschiedliche Weise zugehen:
Persönliche Übergabe
Die persönliche Übergabe ist die sicherste Variante.
Übergeben Sie dem Mitarbeiter das Schreiben persönlich und lassen Sie sich den Erhalt auf einer Kopie quittieren. Idealerweise führen Sie die Übergabe im Beisein eines Zeugen durch.
Zustellung durch Boten
Ein zuverlässiger Bote (z. B. ein Mitarbeitender der Personalabteilung oder eine externe Zustellperson) übergibt die Kündigung bzw. stellt diese per Posteinwurf oder persönlich zu.
Achtung: Der Bote muss Kenntnis über den Inhalt bzw. die Art des zu übermittelnden Schreibens haben. D.h., dass die Person den Brief selbst gesehen haben muss, bevor er in den Umschlag gelegt wurde. Er muss auch hinterher dazu aussagen können, was der Inhalt des Schreibens war und ob das Schreiben (und von wem) unterschrieben war. Auch den Briefumschlag mit der Adresse muss der Bote prüfen und im Konfliktfall beschreiben können. Er muss weiterhin dies und auch den Zeitpunkt der Zustellung dokumentieren.
Wählen Sie eine vertrauensvolle Person aus, die im Streitfall als Ihr Zeuge agieren kann.
Einwurf-Einschreiben
Wird das Kündigungsschreiben per Einwurf-Einschreiben in den Briefkasten des Mitarbeiters eingeworfen, gilt es in der Regel am Tag des Einwurfs als zugegangen. Diese Variante bietet einen verhältnismäßig guten Nachweis. Einlieferung und Auslieferungsbeleg sollten gut verwahrt werden. Im Rechtsstreit kann hierdurch der sogenannte Anscheinsbeweis über den Zugang erbracht werden.
Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht am 30.01.2025 entschieden, dass der Einlieferungsbeleg und der Online-Sendungsstatus eines Einwurf-Einschreibens allein nicht ausreichen, um den Zugang einer Kündigung per Anscheinsbeweis nachzuweisen (BAG, Urteil v. 30.01.2025 – 2 AZR 68/24). Vielmehr sei eine Reproduktion des Auslieferungsbelegs nötig, Vortrag zur Art und Weise, wie die Zustellung von dem Postmitarbeiter dokumentiert wurde und welcher Postmitarbeiter die Zustellung vornahm. Diese Informationen sowie die Produktion des Auslieferungsbelegs müssen vom Postdienstleister angefordert werden.
Aufgrund dieser hohen Anforderungen, damit der Anscheinsbeweis für ein Einwurf – Einschreiben greift, ist derzeit von einer Kündigung per Einwurf – Einschreiben abzuraten.
Einschreiben mit Übergabe-Rückschein
Der Zugang der Kündigung gilt bei der Zustellung per Einschreiben mit Übergabe-Rückschein erst dann als erfolgt, wenn Ihr Mitarbeiter das Einschreiben tatsächlich entgegennimmt. Der Zustellzeitpunkt kann sich dadurch erheblich verzögern. Dies ist daher bei arbeitsrechtlichen Kündigungen, bei denen eine Verzögerung schnell dazu führen kann, dass die Kündigungsfrist um einen Monat oder länger „springt“, nicht zu empfehlen.
Zustellung mittels Gerichtsvollzieher
In wenigen Fällen erfolgt die Zustellung eines Kündigungsschreibens per Gerichtsvollzieher. Ähnlich wie beim Einschreiben mit Übergabe-Rückschein lässt sich dabei jedoch nicht kalkulieren, wie lange die Zustellung dauern wird.
4. Die Bedeutung des Zugangszeitpunkts für Fristen
Die allgemeinen Kündigungsfristen sind – unabhängig von etwaigen anderslautenden arbeits- oder tarifvertraglichen Regelungen – § 622 BGB zu entnehmen.
Der Zugang der darauf basierenden Kündigungserklärung ist nicht nur für deren Wirksamkeit entscheidend, sondern bestimmt letztendlich auch den Beginn wichtiger Fristen.
Für Sie als Arbeitgeber ist der Zugangszeitpunkt maßgeblich für die Einhaltung der Kündigungsfrist.
Beispiel:
Sie möchten das Arbeitsverhältnis mit einem Mitarbeiter zum 30. April kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen Kündigungsfrist zum Monatsende.
Der Zugang der Kündigung beim Mitarbeiter muss in diesem Fall bis spätestens 31. März erfolgt sein. Andernfalls verlängert sich das Arbeitsverhältnis um einen weiteren Monat.
Für den Arbeitnehmer beginnt mit dem Zugang der Kündigung die dreiwöchige Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage gemäß § 4 Satz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG).
5. So vermeiden Sie Fehler – Wann ist eine Kündigung unwirksam?
Ist eine Kündigung nichtig, besteht das Arbeitsverhältnis fort. Das heißt, im Zweifelsfall greift Ihre Verpflichtung zur Beschäftigung und Lohnfortzahlung des Arbeitnehmers.
Die häufigsten Ursachen, warum eine Kündigung rechtlich unwirksam sein kann, sind:
- Es existiert kein rechtlich wirksamer Kündigungsgrund. (z.B. Betriebsübergang)
- Die formalen Anforderungen wurden nicht eingehalten. (Schriftformerfordernis)
- Sie wurde nicht von einer kündigungsberechtigten Person unterzeichnet.
- Sie wurde dem Arbeitnehmer nicht wirksam zugestellt.
- Die gesetzliche oder vertragliche Kündigungsfrist wurde nicht eingehalten.
- Der Betriebsrat war nicht ordnungsgemäß beteiligt (§ 102 BetrVG).
- Es wurde gegen ein gesetzliches Kündigungsverbot verstoßen z. B. Schwangerschaft, Schwerbehinderung, Elternzeit, Betriebsratsmitglied.
- Die Sozialauswahl wurde nicht eingehalten.
- Die Kündigung verstößt gegen Treu und Glauben.
6. Unsere Empfehlung – Lassen Sie sich von einem Experten unterstützen
Eine rechtssichere Kündigung ist komplexer, als es zunächst erscheint. Schon kleine formale Fehler können dazu führen, dass Ihre Kündigung vor Gericht keinen Bestand hat. Zudem gibt es zahlreiche rechtliche Sonderkonstellationen, – vom besonderen Kündigungsschutz bis zu tarifvertraglichen Regelungen – die individuell geprüft werden müssen.
Als Fachanwalt für Arbeitsrecht unterstütze ich Sie gerne dabei, Kündigungen rechtssicher vorzubereiten, auszusprechen und zuzustellen. Gehen Sie auf Nummer sicher und vermeiden Sie unnötige Risiken. Schaffen Sie in diesem wichtigen Thema klare Verhältnisse – rechtlich und unternehmerisch.
7. Fazit
- Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich im Original vorliegt (§ 623 BGB)
- Das Kündigungsschreiben muss von einer kündigungsberechtigten Person unterschrieben sein
- Die Kündigung wird erst mit Zugang beim Arbeitnehmer wirksam
- Für den Zugang zählt nicht das Absendedatum, sondern der tatsächliche oder zumindest rechtlich vermutete Erhalt
- Es gibt unterschiedliche Zustellmethoden mit Zugangsnachweis
- Der Zugangszeitpunkt ist maßgeblich für Fristen, etwa zur Einhaltung der Kündigungsfrist oder zur Kündigungsschutzklage
- Eine unwirksame Kündigung kann zu erheblichen Rechtsfolgen und finanziellen Belastungen führen.
- Frühzeitiger anwaltlicher Rat hilft, Risiken zu minimieren und rechtssicher zu handeln
8. FAQ
Muss eine Kündigung in Papierform erfolgen?
Ja, nach § 623 BGB ist ausschließlich die Schriftform zulässig. Eine Kündigung per E-Mail, Fax oder WhatsApp ist unwirksam – auch dann, wenn der Mitarbeiter den Empfang bestätigt.
Wann gilt eine Kündigung als “zugegangen”?
Sobald das Schreiben so in den Machtbereich des Arbeitnehmers gelangt, dass er unter normalen Umständen davon Kenntnis nehmen kann. Bei Einwurf in den Hausbriefkasten gilt der Zugang in der Regel am selben Tag als erfolgt, wenn dies zu normalen Postzeiten geschieht.
Was passiert, wenn die Kündigung am Wochenende im Briefkasten landet?
Wird die Kündigung z. B. an einem Samstag eingeworfen, gilt sie am nächsten Werktag (meist Montag) als zugegangen – sofern erst dann mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist.
Wer darf die Kündigung unterschreiben?
Nur der Arbeitgeber selbst oder eine künftig klar bevollmächtigte Person, z. B. ein Prokurist oder Personalleiter. Ist die Berechtigung nicht offensichtlich, muss dem Kündigungsschreiben eine Originalvollmacht beigefügt werden (§ 174 BGB).
Wann sollte ich rechtlichen Rat einholen?
Spätestens dann, wenn Sie sich bei Form, Fristen, Zustellung oder Sonderkündigungsschutz unsicher sind. Ein frühzeitiges Gespräch mit einem Fachanwalt für Arbeitsrecht verhindert spätere Prozesse und teure Fehler.
Bildquellennachweis: Bhutinat65 | Canva.com